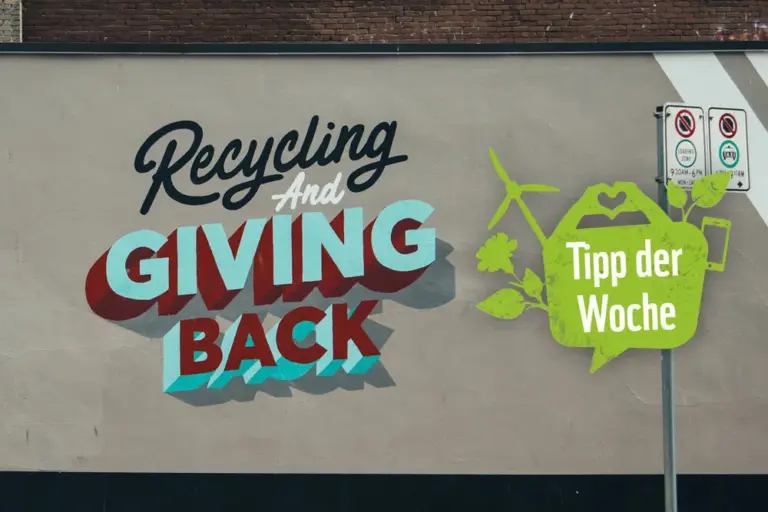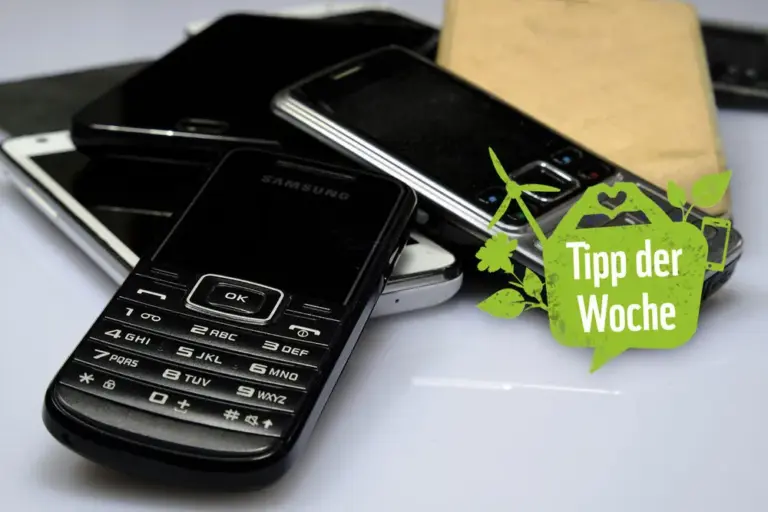Beim Stichwort Klimakrise und Emissionen denkst du vermutlich als erstes an Kohle, Öl und Gas, an Verkehr, Strom, vielleicht noch an Ernährung und Landwirtschaft.
Doch es gibt noch eine weitere Quelle: Mülldeponien. In dieser Story erfährst du, in welchem Maß Mülldeponien zur Klimakrise beitragen, warum das so ist und was getan werden kann.
Lass dir die Infos nicht entgehen!
Klimawandel und Methan
Durch unsere Aktivitäten verstärken wir Menschen den natürlichen Treibhauseffekt und bringen das Klima dazu, sich zu erwärmen und zu verändern. Doch nicht nur CO2 trägt zum anthropogenen (= vom Menschen verursachten) Treibhauseffekt bei, sondern auch weitere Gase. Neben CO2 sind das im Wesentlichen Methan (CH4) und Lachgas (N2O).
Vergleicht man CO2 und Methan, wird schnell klar: Methan ist kurzzeitig bis zu 80-mal klimaschädlicher als CO2, in einem Zeitraum von 100 Jahren ca. 30-mal.
Es verbleibt mit 12 Jahren zwar vergleichsweise kurz in der Atmosphäre, doch es kann enorme Mengen Wärme in der Erdatmosphäre speichern. Seit Beginn der Industrialisierung ist Methan ungefähr für ein Drittel des globalen Temperaturanstiegs, also ca. 0,5°C, verantwortlich.
Das ist viel – doch da Methan vergleichsweise kurz in der Atmosphäre verbleibt, sind Methanemissionen ein großer Hebel im Klimaschutz.
Betrug die Methankonzentration in der Atmosphäre 1750 noch 722 ppb (parts per billion), liegt sie inzwischen bei etwa 1.900 ppb. In den letzten 650.000 Jahren lag die Konzentration noch nie so hoch.

Feuchtgebiete sind eine natürliche Methanquelle. /
© Dani Egli, pixabay.com
Natürlicherweise entsteht Methan in Feuchtgebieten, z.B. wenn sich Pflanzen in Mooren zersetzen oder wenn Permafrostböden (Böden, die dauerhaft gefroren sind) auftauen.
Doch das macht nur einen Teil der Methanemissionen aus.
60% der Emissionen haben ihren Ursprung in menschlichen Aktivitäten. Die Landwirtschaft – speziell die Tierhaltung – spielt hier eine große Rolle und hat einen Anteil von etwa 40%. Der Abbau von Kohle, Öl und Gas trägt weitere 35% bei.
Und weitere 22% stammen aus Mülldeponien und Abwässern. Den größten Anteil hierbei haben die Deponierung und die Abfallbehandlung.

Nach der Tierhaltung sind Mülldeponien für einen erheblichen Teil der menschengemachten Methanemissionen verantwortlich. /
© Dinh Khol Nguyen, pixabay.com
Emissionen aus Mülldeponien
Wir sehen: Mülldeponien haben also einen erheblichen Anteil an den menschengemachten Methanemissionen – der den meisten Menschen nicht einmal bekannt sein dürfte. Global gesehen ist der Abfall- und Abwassersektor der drittgrößte Methanemittent.
Aber wie entsteht eigentlich Methan auf Mülldeponien?
Hier spielen besonders organische Verbindungen eine Rolle, z.B. Essensreste oder andere organische Stoffe, die auf die Mülldeponie gelangen. Werden diese von Bakterien abgebaut, entsteht dabei Methan. Und dieses Methan entweicht in die Umgebung.
Jede Tonne ungetrennter Hausmüll verursacht etwa 150-200 Kubikmeter Deponiegas – und das besteht zu 60% aus Methan.
Gut gebaute Deponien schließen den Abfall gas- und wasserdicht ein. Das Deponiegas kann dort nur schwer entweichen und wird im Idealfall zur Strom- oder Wärmeerzeugung genutzt.
Aber auch bei modernen Deponien kann Methan nicht vollständig aufgefangen werden. In Deutschland werden etwa 57% erfasst, in Spanien z.B. nur 18%. Abgedichtete Deponien geben Methan ab, wenn die Gasabsaugung ausfällt oder wenn die Deponie teilweise geöffnet werden muss.
Bei Deponien ohne Abdichtung der Oberfläche sind die Emissionen natürlich weitaus höher.

Aus offenen Deponien kann das entweichende Methan nicht aufgefangen werden. /
© Heamna Manzur, pixabay.com
In der EU sind Abfalldeponien der zweitgrößte Methanemittent, obwohl die Emissionen im Vergleich zu 1990 deutlich zurückgegangen sind. Im Jahr 2021 wurden EU-weit etwa 2.800 Kilotonnen Methan aus Deponien emittiert, 1990 noch etwa 5.500 Kilotonnen. Doch es gibt Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern: Länder, die die EU-Deponierrichtlinie mit Ablagerungsverboten, Vorbehandlungen und/oder Annahmekriterien für Deponien national umgesetzt haben, konnten ihre Methanemissionen im Abfallsektor erheblich senken. Einige EU-Staaten deponieren jedoch weiterhin einen großen Teil der Abfälle unbehandelt auf Deponien, was zu den insgesamt hohen Emissionen des Abfallsektors in der EU beiträgt und die Klimabilanz dieser Länder sowie der EU verschlechtert.
In Deutschland sind die Emissionen aus der Abfalldeponierung in den letzten 30 Jahren kontinuierlich gesunken.
Global gesehen hat Deutschland in der Vermeidung und Verminderung von Methanemissionen aus Abfällen eine Vorreiterrolle. Das liegt hauptsächlich daran, dass geordnete Deponien schon vor einigen Jahrzehnten eingeführt und bereits seit 1993 die Erfassung von Deponiegasen verpflichtend ist. Soweit technisch möglich, wird das Deponiegas energetisch verwertet. Ebenfalls erhebliche Wirkung geht auf das Verbot zurück, dass seit 2005 keine unbehandelten Siedlungsabfälle mehr deponiert werden dürfen. Betrugen die Methanemissionen aus Deponien in Deutschland 1990 noch 1,33 Millionen Tonnen, lagen sie 2023 nur noch bei 0,08 Millionen Tonnen.
Was auf Deponien landet und was nicht, hat also eine ganz entscheidende Wirkung auf die späteren Methanemissionen.

Die Getrenntsammlung von Abfällen reduziert den Methanausstoß in der Abfallwirtschaft. /
© Zibik, pixabay.com
Wo steht die Politik?
Auch die Politik hat erkannt, dass Methanemissionen eine Rolle bei der Klimakrise spielen und entsprechende Maßnahmen getroffen werden müssen. Die EU hat sich z.B. im Global Methane Pledge dazu verpflichtet, die Methanemissionen bis 2030 um 30% zu senken (im Vergleich zu 2020).
Auch der European Green Deal befasst sich in Teilen mit Methanemissionen, primär jedoch mit Lecks an Pipelines und das Abfackeln von Methan an Erdgasförderstätten.
Dabei hätte eine Verringerung der Methanemissionen deutliche Auswirkung auf den Verlauf der Erderwärmung: Würde es uns gelingen, die Methanemissionen in den nächsten 10 Jahren zu halbieren, würde die Erderwärmung laut UN dadurch 0,3°C geringer ausfallen.
Dieses Video fasst die wichtigsten Infos noch einmal zusammen (10:46 Min, deutsch, Untertitel zuschaltbar):
Das Umweltbundesamt (UBA) hat 2025 ein Positionspapier zum Treibhausgas Methan herausgegeben. Darin werden folgende Maßnahmen für den Abfallsektor genannt:
- Deponierung von Bioabfällen weltweit beenden
- Getrenntsammlung von Abfällen und Kompostierung, Vergärung sowie energetische Nutzung von Bioabfällen weltweit ausweiten
- Lebensmittelabfälle reduzieren
- Deponiegas erfassen und energetisch verwerten
- Minderungspotentiale besser kommunizieren und Messungen von Emissionen verbessern
In der EU-Deponierrichtlinie wurde das Ziel gesetzt, die Deponierung von unbehandelten Siedlungsabfällen in der EU bis 2035 auf 10% zu senken. Allerdings können Mitgliedsstaaten eine Fristverlängerung beantragen und die Richtlinie stellt kein umfassendes Ablagerungsverbot dar – damit bleiben Möglichkeiten ungenutzt, die technisch möglich wären.

In einigen EU-Ländern gibt es noch Nachholbedarf bei der Mülltrennung und Deponierung. /
© Miroslav Gecovic, pixabay.com
Das können wir tun
Auf den ersten Blick könnte man meinen, dass wir als einzelner Mensch wenig Einfluss auf Methanmissionen aus Mülldeponien haben. Doch das, was das UBA von der Politik fordert, können wir größtenteils auch zu Hause umsetzen.
Sammle Bioabfälle getrennt und wirke vielleicht sogar in eurem Mehrfamilienhaus darauf hin, dass die Mülltrennung verbessert wird. Wirf keine Lebensmittel weg – schau z.B. im Team „Ernährung“, welche Rezepte es für Radieschenblätter, altes Brot etc. gibt oder was sich hinter dem Begriff „Fairteiler“ verbirgt.
Last but not least: nutze verschiedene Kontaktmöglichkeiten mit Politiker:innen, um auf politische Vorgaben und Ziele zur Emissionsminderung auch im Bereich Methan zu drängen.
Übrigens: Auch der WWF ist beim Thema Müll aktiv. Er setzt sich nicht nur gegen Plastikverschmutzung ein, sondern fördert durch Schulungen und Aufbau entsprechender Infrastruktur auch die getrennte Sammlung von Abfällen in Regionen in Asien, die nicht an die Abfallentsorgung angeschlossen sind. Und der WWF hat sogar ein Satellitentool mitentwickelt, mit dem illegale Müllhalden aus dem All entdeckt werden können.
Quellen
Umweltbundesamt: Positionspapier „Unterschätztes Treibhausgas Methan. Quellen, Wirkungen, Minderungsoptionen“, Stand: August 2025, unter https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/479/publikationen/2025_uba_pos_methanminderung_de_barrierefrei.pdf (Zugriff am 1.11.2025)
MDR: „Mülldeponien stoßen mehr Methan aus als bisher gedacht“ vom 12.8.2022, unter https://www.mdr.de/wissen/muelldeponien-geben-viel-mehr-methan-an-die-atmosphaere-ab-als-gedacht-100.html (Zugriff am 1.11.2025)
RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND): „Methanemissionen: Welche Rollen spielen Mülldeponien?“ vom 13.11.2021, unter https://www.rnd.de/wissen/methan-und-klima-welche-rolle-spielen-muelldeponien-KQHYCT2GPNGDLGYXSZXW4E3CSE.html (Zugriff am 1.11.2025)
RTL News: „Methan: Darum ist es so gefährlich fürs Klima. Klima Update Spezial“, unter https://www.youtube.com/watch?v=V0Q6-rYu17A (Zugriff am 1.11.2025)
Deutsche Welle (DW)/Beatrice Christofaro: „Was ist Methan und was hat es mit dem Klima zu tun?“ vom 22.10.2025, unter https://www.dw.com/de/methan-was-ist-das-eigentlich-treibhausgas-klimawandel-atmosphäre-globale-erwärmung-landwirtschaft/a-70018343 (Zugriff am 1.11.2025)