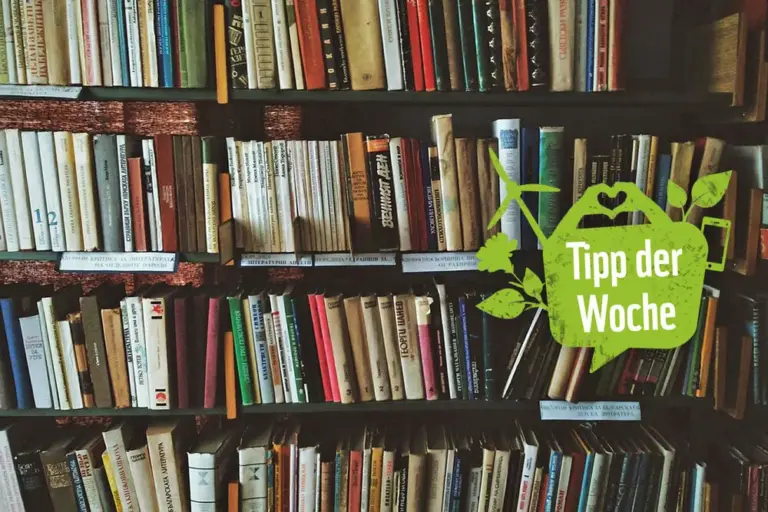Kraftvoll, verwunschen, mystisch – der Wald hat auf uns eine magische Anziehungskraft. Die überwiegende Zeit unserer Entwicklungsgeschichte lebten wir Menschen im und vom Wald. Doch inzwischen scheinen wir die Verbindung zur Natur zu verlieren. Wird der Wald uns fremd? Nicht, wenn wir uns wieder auf das Abenteuer einlassen, ihn neu zu entdecken.
In diesen Wochen bekommst du bei uns viele Inspirationen und Anregungen, wie du wieder mehr Zeit im Wald verbringen kannst. Wir laden dich ein, diesen Frühling zu deinem Waldfrühling zu machen!
In den letzten Wochen haben wir uns viel mit dem Wald, vor allem mit dem vor unserer eigenen Haustür beschäftigt. Ob diese Wälder aber den Namen „Wald“ verdient haben, darüber lässt sich streiten. Einer meiner Dozenten an der Uni sagt nein. Für ihn fällt der überwiegende Teil der Wälder Deutschlands unter den Begriff „Forst“. Zwar sind 32% der Gesamtfläche Deutschlands (11,4 Millionen Hektar) von Wald bedeckt, echte Urwälder, in denen noch nie der Mensch eingegriffen hat, haben wir aber so gut wie gar nicht mehr. Die meisten Wälder werden seit dem Mittelalter bewirtschaftet oder sind noch gar nicht so alt und wurden erst später angepflanzt. Was es in Deutschland aber gibt, sind Flächen, auf denen wir Menschen „Natur Natur sein lassen“ wollen. Die Rede ist von Nationalparks.
Nationalparks? Da denken viele gleich an den Yellowstone Nationalpark in den USA (der übrigens schon 1872 gegründet wurde und somit der älteste Nationalpark der Welt ist). Aber die wenigsten Deutschen könnten wohl alle 16 (!) Nationalparks in Deutschland aufzählen. Klar, 9000 Quadratkilometer wie der Yellowstone-Park haben wir hier nicht zu bieten. Alle 16 Parks zusammen kommen nicht einmal auf ein Prozent der Gesamtfläche Deutschlands.
136 000 Hektar Wald (das sind ca. 190 Fußballfelder) werden durch die Nationalparks besonders geschützt. 13 der 16 Parks sind hauptsächlich durch Wälder geprägt, die in den Kernzonen nicht forstwirtschaftlich genutzt werden. Nach dem Bundesnaturschutzgesetz müssen Nationalparks einheitlich geschützte Gebiete sein, die großräumig und von besonderer Eigenart sind, im überwiegenden Teil des Gebietes die Voraussetzung für ein Naturschutzgebiet erfüllen, sich in einem vom Menschen wenig beeinflussten Zustand befinden und vornehmlich der Erhaltung möglichst artenreicher heimischer Tier- und Pflanzenbestände dienen. Auch darüber, wie gut diese Punkte alle erfüllt sind, kann man sicherlich streiten. Die Hauptsache ist aber doch, dass es sie gibt. Und damit es euch nicht wie mir geht und ihr erst im Nachhinein feststellt, dass ihr gerade durch einen Nationalpark wandert (und dass obwohl ich schon in einem von ihnen gearbeitet habe), möchte ich sie euch hier kurz vorstellen. Da dieser Bericht Teil des Waldfrühlings ist fallen die drei Wattenmeer-Nationalparks leider raus, was aber auf gar keinen Fall heißen soll, dass sie weniger wichtig oder spannend sind! (Vielleicht gibt es dazu einfach mal einen eigenen Bericht. Wer trotzdem jetzt schon etwas über den Lebensraum Watt lernen möchte, kann das zum Beispiel in diese Podcastfolge von Löffelkraut tun. Und wer etwas gegen Erdgasbohrungen im Wattenmeer tun möchte, kann direkt diese Petition unterschreiben.)
Aber zurück zu unseren Wald-Nationalparks. Da das auch ganz schön viele sind, geht es heute erst mal nur nach Süd- und Mitteldeutschland. Der Rest folgt in Teil 2.
1. Der Älteste: Nationalpark Bayrischer Wald
Der Bayrische Wald ist Deutschlands ältester Nationalpark. Zwar wurde schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts ein Nationalpark in dem Gebiet gefordert, eröffnet wurde er aber erst am 7. Oktober 1970 und somit fast 100 Jahre nach dem Yellowstone-Park. Dass mit dem Park vor allem Waldgebiete geschützt werden sollten, steckt ja schon im Namen. 98 Prozent des 243 Quadratkilometer großen Schutzgebiets sind mit Wald bedeckt. Da es auf der tschechischen Seite ebenfalls einen Nationalpark gibt (den Nationalpark Šumava) stehen insgesamt ca. 68 000 Hektar des Böhmerwaldes unter Schutz. Beide Parks zusammen bilden damit das größte Waldschutzgebiet Europas. Die Geschichte des Böhmische Massiv, zu dem zum Beispiel der Große Falkenstein und der Große Rachel gehören, begann im Präkambrium mit der Ablagerung von Sedimenten. Mischwald wächst dort erst seit ca. 3000 Jahren. Nach der Eiszeit gab es erst einmal vor allem Birken und Haseln. Dass der Wald heute Nationalpark ist, verdankt er wohl der ungewöhnlich späten Nutzung durch den Menschen. Erst im 19. Jahrhundert wurden forstwirtschaftliche Nutzungspläne für das Gebiet erstellt. Vielleicht ein Grund: Zur Zeit der Römer bis ins Mittelalter hinein wurde es als „Nordwald“ für seine Gefahren gefürchtet. Zwar wurden die Flächen später dann doch genutzt, es konnten sich aber kleine ungenutzte Stücke (vor allem in Hanglage) erhalten, auf denen unter anderem natürlicherweise Fichten wachsen! In der Geschichte des Nationalparks kam es mehrfach zu Borkenkäfer-Ausbrüchen, die vor allem von dem Nationalparkgegnern als Argument gegen den Park genutzt wurden. Besitzer der angrenzenden Wälder fürchteten um ihre eigenen Bäume. Auf den betroffenen Nationalparkflächen lässt sich heute eine natürliche Waldverjüngung beobachten, wie es ihn in forstwirtschaftlich genutzten Wäldern nicht mehr gibt.

2. Nationalpark in Entwicklung: Der Schwarzwald
Deutlich jünger ist Baden-Württembergs einziger Nationalpark, der den Wald auch schon im Namen trägt: Der Nationalpark Schwarzwald wurde erst 2014 gegründet und deckt auch nicht den ganzen Schwarzwald, sondern nur den Nordschwarzwald ab. Mit zehn Hektar Fläche ist er deutlich kleiner als der Bayrische Wald, enthält aber trotzdem eine große Vielfalt an Landschaften: Wälder, Hochmoore und durch Gletscher geschaffene Karseen. Eine Besonderheit sind auch die sogenannten „Grinden“ (Glatzen). Diese kahlen Stellen entstanden an Hochlagen, die ab dem Mittelalter für Weideflächen brandgerodet wurden und heute als Feuchtheiden wichtige Lebensräume für Arten wie Baumpieper oder Kreuzottern sind. Zwar wurde die heutige Nationalparkfläche früher intensiv genutzt, weshalb der Park als Entwicklungsnationalpark gegründet wurde, dessen Fläche nach und nach ganz der Natur überlassen wird, es gibt aber auch zwei Bannwälder, die schon seit ca. 100 Jahren sich selbst überlassen sind. Es wird davon ausgegangen, dass sich der noch durch Fichten dominierte Wald in Zukunft zu einem Mischwald mit Fichten, Weißtannen und Rotbuchen wandeln wird. Mit fast 20 Prozent ist der Tannenanteil im Schwarzwald jetzt schon der höchste unter den deutschen Nationalparks. Das Maskottchen des Nationalparks ist übrigens der Sperlingskauz, die kleinste Eule Europas.

3. Der höchste: Nationalpark Berchtesgaden
Berchtesgaden ist vor allem für den Königssee und den Watzmann, der mit 2713 Metern der zweithöchste Berg Deutschlands ist, bekannt. 1799 wurde er zum ersten Mal bestiegen. Seitdem gab es schon 100 tödliche Unfälle an der Ostwand des Watzmanns. Eine Sage erzählt, dass es einst ein böser Herrscher und seine Familie eine Bauernfamilie töteten und dafür von der Großmutter verflucht wurden. Die Herrscherfamilie wurde dadurch in große Felsen verwandelt: Den Watzmann, die Watzmannfrau und die Watzmannkinder, wie der Kleine Watzmann und die sieben Nebengipfel auch genannt werden. Dass einige Stellen des Nationalparks so steil sind, kommt der Natur zugute. Im Gegensatz zu den meisten anderen Nationalparks ist in Berchtesgaden auch die Kernzone des Parks frei zugänglich. Durch Hütten zur Übernachtung, die vielen Bergsportler und die Seilbahnen in unmittelbarer Nähe zum Park lässt sich eine Störung der Natur nicht komplett vermeiden. Da aber einige Hänge so steil sind, gibt es genug Stellen, die fast nie von Menschen betreten werden. Schon 1910 gab es in den Berchtesgadener Alpen ein Pflanzenschongebiet. 1970 wurde ein Seilbahnprojekt auf den Watzmann gestoppt. Gegründet wurde der 210 Quadratkilometer große Nationalpark 1978 und ist heute Brutplatz von einem Dutzend Steinadlerpärchen. Und noch eine Besonderheit gibt es hier: Seit 2021 läuft ein Auswilderungsprogramm für den in Deutschland ausgestorbenen Bartgeier. Dieses Jahr wurden zum dritten Mal zwei junge Bartgeier ausgewildert. Ihr könnt sie sogar live im Internet in ihrer Auswilderungsnische beobachten.

4. Der jüngste: Nationalpark Hunsrück-Hochwald
Zwar wurde der Nationalpark Hunsrück-Hochwald erst 2015 gegründet und ist damit derzeit der jüngste Nationalpark Deutschlands, seine Geschichte geht aber schon viel weiter zurück. Der 2,5 Kilometer lange Keltische Ringwall bei Otzenhausen gilt als das besterhaltene keltische Monument in Deutschland. Auch die Römer waren hier. Später fand im Hunsrück Eisenverhüttung statt. Die dafür benötigte Holzkohle wurde aus den Wäldern vor Ort gewonnen, wodurch diese gr0ßflächig abgeholzt wurden. Wie auch der Schwarzwald ist der Hunsrück-Hochwald ein Entwicklungsnationalpark. Das heißt, es gilt zwar der Grundsatz „Natur Natur sein lassen“, aber in der Anfangsphase wird ein wenig nachgeholfen, indem zum Beispiel Moore renaturiert und standortheimische Baumarten gepflanzt werden. Etwa die Hälfte des 10200 Hektar großen Nationalparks besteht jetzt schon aus natürlich vorkommenden Buchenwäldern, im Rest des Parks stehen aber noch viele zur Holzgewinnung angepflanzte Fichten. Trotzdem bewertet das Bundesamt für Naturschutz den Hunsrück heute schon als „Hotspot-Region für biologische Vielfalt“. Da es in einer sehr ländlichen Region an der Grenze vom Saarland zu Rheinland-Pfalz liegt, bietet das Mittelgebirge mit seinen Wäldern viel Ruhe, die zum Beispiel Wildkatzen und Schwarzstörche benötigen. Beide Arten sind sehr scheu und kommen im Nationalpark vor. Eine seltene Pflanzenart im Nationalpark ist die für ihre heilende Wirkung bekannte Arnika.

5. Das Kletterparadies -Nationalpark Sächsische Schweiz
Schon im 18. Jahrhundert kamen Reisende, um das Elbsandsteingebirge zu sehen. Viele Maler wie Caspar David Friedrich haben die Landschaft gemalt, weshalb es heute den sogenannten Malerweg gibt. Im 19. Jahrhundert begann dann die Geschichte des sportlichen Felsenkletterns in der sächsischen Variante. Um die empfindlichen Sandsteine zu schützen, sollte auf künstliche Hilfen verzichtet werden. Wie und mit welchen Mitteln in der Sächsischen Schweiz geklettert werden durfte, wurde 1913 in den „Sächsischen Kletterregeln“ festgelegt, die in einer aktualisierten Form bis heute angewendet werden. Im 20. Jahrhundert wurden bereits einzelne Gebiete unter Schutz gestellt, bevor die DDR 1990 kurz vor der Wiedervereinigung noch die Schaffung von fünf Nationalparks beschloss, mit dabei die Sächsische Schweiz. Eine Besonderheit: Der 93 Quadratkilometer große Nationalpark besteht aus zwei Teilen, die räumlich getrennt sind, der Vorderen und der Hinteren Sächsischen Schweiz. An einigen Stellen wird auch das Ufer der Elbe miteingeschlossen, die Elbe selbst als Bundeswasserstraße gehört nicht zum Park. Da es auf tschechischer Seite ebenfalls einen Nationalpark gibt, die Böhmische Schweiz, stehen ca. Dreiviertel des Elbsandsteingebirges unter Schutz. Zur Kreidezeit befand sich an dieser Stelle ein Meer, in dem sich durch die Ablagerung von Sedimenten eine 600 Meter mächtige Sandsteinplatte bildete. Später entstand durch Erosion und Abtragung die heutige Landschaft mit bekannten Felsen wie der Bastei, der Lokomotive und Tafelbergen wie dem Lilienstein, dem Wahrzeichen des Nationalparks. Wie in vielen Regionen Deutschlands wurden auch hier die ursprünglichen Buchen-, Misch- und Kiefernwälder weitgehend abgeholzt und Fichten gepflanzt. Diese Flächen sollen im Nationalpark renaturiert werden, weshalb Buchen, Eichen und Tannen wiederangesiedelt werden. Nur an Stellen, an denen die Buchen- bzw. Kiefernwälder erhalten geblieben sind, wird jetzt schon nicht mehr eingegriffen.

6. Der größte Laubwald- Nationalpark Hainich
Mitten in Deutschland, in Thüringen liegt der Nationalpark Hainich, der weltweit eine Besonderheit ist, weil er als einziger Nationalpark Kalkbuchenwälder auf Muschelkalk unter Schutz stellt. Auch innerhalb Deutschlands ist das Gebiet etwas Besonderes, da es sich mit 16 000 Hektar Waldfläche um Deutschlands größtes zusammenhängendes Laubwaldgebiet handelt. Obwohl auch der Hainich schon jahrhundertelang genutzt wurde, sind hier die Wälder im Gegensatz zum Rest des Landes relativ naturnah geblieben. Ein Grund dafür ist die besondere Bewirtschaftungsform, auf die schon im 19. Jahrhundert umgestellt wurde. Damals wurde auf strukturelle Hochwälder unterschiedlicher Altersstufen umgestellt, was vor allem in Laubwäldern nur selten gemacht wurde. Im 20. Jahrhundert entstanden zwei Militärübungsplätze im Hainich. Dort wurde zwar beispielwiese der Boden durch Panzer verdichtet, aber da auf weitere Nutzungen verzichtet und der Zugang zum Wald für die Bevölkerung gesperrt war, hatten viele seltene Tier- und Pflanzenarten ihre Ruhe. Zum Beispiel leben hier mehr als 480 Käferarten, denen vor allem das Totholz, das hier im Wald bleibt, zu Gute kommt. 1997 wurden 7500 Hektar des Gebietes zum Nationalpark. Auf den ehemaligen Übungsplätzen kann heute eine Sukzession beobachtet werden, eine zeitliche Abfolge von Pflanzenarten, die sich nach und nach die Fläche zurück holen, bis dort wieder Wald wächst. Der Hainich gehört zum durch die UNESCO geschützten Gebiet „Buchenwälder in den Karpaten und alte Buchenwälder in Deutschland“.

7. Der zweitkleinste– Nationalpark Kellerwald-Edersee
Ebenfalls wegen seiner alten Buchenwälder ist der Nationalpark Kellerwald-Edersee in Nordhessen seit 2011 UNESCO Weltnaturerbe. Der mit 5724 Hektar zweitkleinste Nationalpark Deutschlands war früher ein fürstliches Jagdrevier. Besonders macht ihn vor allem das Alter seiner Buchenwälder. 40 Prozent der Bäume sind über 140 Jahre alt, die älteste Buche im Schutzgebiet hat sogar 260 Jahre auf dem Buckel. Grund dafür ist die historisch stark vernachlässigte Bewirtschaftung des Waldes, die dazu geführt hat, dass das Gebiet des heutigen Nationalparks von größeren Rodungen verschont blieb. Bis es zu Hessens erstem und einzigem Nationalpark wurde, gab es allerdings mehrere Bürgerentscheide, die das verhinderten. 1998 wurde nur eine nutzungsfreie Kernzone eingerichtet, offizielle Nationalpark wurde der Kellerwald erst 2004. Ziel des Parks ist ein Wald, der alle Merkmale früherer Urwälder aufweist. Jede forstwirtschaftliche Nutzung ist im Gebiet daher untersagt. Eine Besonderheit des Kellerwalds sind ca. 500 im Nationalpark liegende Quellen mit ihrer spezifischen Flora und Fauna. Wie auch im Hainich finden hier die Bewohner von Totholz sowie 15 Fledermaus- und sechs Spechtarten einen Lebensraum. 2007 konnten zum ersten Mal seit 50 Jahren wieder Wildkatzen im Kellerwald nachgewiesen werden.

So, hier fehlen jetzt noch Jasmund, Müritz, Unteres Odertal, Vorpommerische Boddenlandschaft, Eifel und Harz. Wer mehr über diese 6 Nationalparks erfahren möchte, muss auf Teil 2 warten.
Schon einmal selbst Wildkräuter gesammelt und daraus Hustensaft oder ein Pesto gemacht? Nein? Dann schau dir doch Sarahs Bericht und Video von letzter Woche an, in dem sie 5 Wildkräuter vorstellt.
Kaum zu glauben aber nächste Woche gibt es hier schon die letzte von sechs Waldaufgaben. Du hast die anderen fünf Aufgaben noch gar nicht gemacht? Kein Problem, alle Aufgaben und Berichte rund um den Waldfrühling findest du im Team Natur schützen.
Quellen
„Wildes Deutschland Der umfassende Reiseführer zu allen Nationalparks mit ausgewählten Touren und Expertentipps“, Norbert Rosing, 2. Auflage
https://de.wikipedia.org/wiki/Wald_in_Deutschland
https://www.waldhilfe.de/urwald-in-deutschland/
https://de.wikipedia.org/wiki/Nationalparks_in_Deutschland

Eine Story von Johanna
Johannna schreibt ehrenamtlich für die WWF Jugend Community. Sie ist im Redaktions- und Aktionsteam. Auch du kannst hier mitmachen – komm in unser Team.